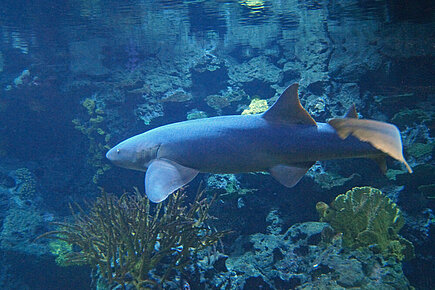Der bekannte südafrikanische Haischützer Andrew Cobb formulierte es einmal so: „Wenn die Haie sterben, stirbt das Meer. Wenn das Meer stirbt, werden wir folgen!“. Was heißt das genau? Der Hai wird auch oft als „Wolf des Meeres“ bezeichnet, und der Vergleich ist durchaus zutreffend. Ein Beispiel soll zeigen, wie die Wiedereinführung von Wölfen den Yellowstone-Nationalpark in den USA regenerierte und welche Parallelen man zu den Haien ziehen kann. Von Küste zu Küste und von der Arktis bis Zentralmexiko durchstreiften Wölfe einst ganz Nordamerika. In Alaska und Kanada sind sie noch relativ häufig, aber durch die Ausrottungsprogramme und den Lebensraumverlust der vergangenen Jahrhunderte sind sie aus den 48 zusammenhängenden US-Bundesstaaten beinahe ganz verschwunden. In den 1930er Jahren gab es nur noch im Norden kleine Bestände. Trotz vieler Kontroversen wurden 1995 und 1996 im Yellowstone-Nationalpark in Wyoming/USA und im Bundesstaat Idaho 66 Wölfe angesiedelt, die sich in diesen Gebieten seit 1926 nicht mehr fortgepflanzt hatten. Bis 2007 wuchs die Population auf etwa 1.500 Tiere an.
Wölfe haben seitdem erhebliche Wirkungen im Yellowstone ausgelöst, die sich durch das gesamte „Nahrungsnetz“ gezogen haben, das Biodiversität im Ökosystem der Nördlichen Rocky Mountains definiert. Ökologische Interpretationen dieser Auswirkungen haben einen signifikanten Beitrag zu der Debatte geleistet, welche Wirkungskräfte das Verschwinden von Pflanzenfressern und von Vegetation im Yellowstone- Nationalpark bestimmt: Wirken „Top-Down“-Kräfte vom Wolf als oberstes Glied der Nahrungskette nach unten über seine Beutetiere auf die Vegetation? Oder wirken „Bottom-Up“-Kräfte vom Wasserhaushalt über die Vegetation auf die Beutetiere und schließlich auf den Wolf?
Mit dieser Thematik beschäftigt sich die Studie „Yellowstone Wolves and the Forces that Structure Natural Systems“ von Andy P. Dobson, die am 23. Dezember 2014 in der Fachzeitschrift PLOS Biology erschienen ist. Nach der Wiederansiedelung der Wölfe kam es zu einem deutlichen Rückgang der Wapiti- Hirsch-Population. 70 Jahre lang gab es hier keine Wölfe. Dadurch hatte die Population an Hirschen enorm zugenommen, weil es kaum noch natürliche Feinde für sie gab. Diese taten sich an Bäumen und Gräsern gütlich, so dass die Pflanzen nicht mehr richtig wuchsen. Dadurch wurden nicht nur andere Tierarten verdrängt, deren Lebensraum zerstört wurde, sondern auch der Lauf der Flüsse veränderte sich, da die Ufer weniger stabil waren. Die Bodenerosion verstärkte sich ebenfalls durch den Kahlfraß. Der Rückgang der Hirsch-Population ließ sich allerdings nicht alleine durch die Zahl der von den Wölfen gerissenen Wapitis erklären. Offensichtlich mieden die Hirsche bestimmte Gebiete, in denen sie besonders gefährdet waren, und wichen auf schlechtere Futterplätze aus. Dies führte in den von den Wapitihirschen gemiedenen Gebieten zu einer Veränderung der Vegetation: Pflanzen- und Baumarten, die sich bisher nicht ausbreiten konnten, weil sie von den Wapitis geäst worden waren, breiteten sich nun wieder aus. Da viele Wapiti- Hirsche von den Wölfen gerissen wurden, starben weniger Wapitis im Laufe des Winters einen natürlichen Tod. Das hatte spürbare Folgen für die im Yellowstone lebenden Grizzlys: Sie fanden deutlich weniger während des Winters gestorbene, tiefgefrorene Wapitis als Futterquelle vor. Die Grizzlys waren daher gezwungen, sich eine weitere Nahrungsquelle zu erschließen: Bisons. Die von den Grizzlys gerissenen Bison- Kadaver eröffneten wiederum zusätzliche Nahrungsmöglichkeiten für Geier und Adler.
Die Wölfe verringerten auch die Kojotenbestände, was zu einer höheren Überlebensrate der Gabelbockkälber führte, der bevorzugten Beute von Kojoten. Mit dem deutlichen Rückgang der Rentier- Population, deren Population vor der Wiederansiedelung der Wölfe ein Allzeit-Hoch erreicht hatte, waren auch die Wölfe gezwungen, zusätzlich auf Bisons als Beutetiere auszuweichen. Die Jagd auf die Bisons wiederum zwang die Wölfe, ihr Jagdverhalten zu verändern: Für die erfolgreiche Jagd auf Bisons waren größere Jagdverbände notwendig, zu denen sich die Wölfe zusammenschließen mussten. Folglich gab es wieder mehr Wölfe, die für ein ausgeglichenes Ökosystem sorgten.