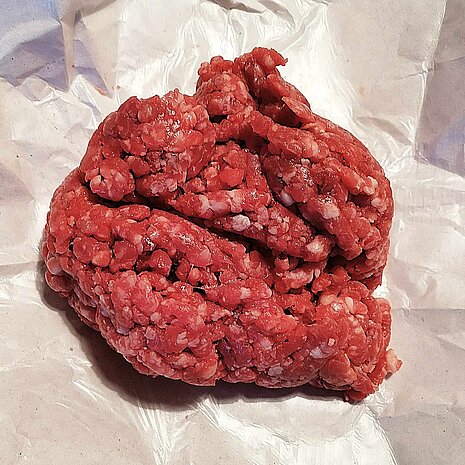Schweine in Freilandhaltung fühlen sich sauwohl
In Deutschland werden knapp 21 Millionen Mast- und Zuchtschweine gehalten. Über 98 Prozent davon ausschließlich im Stall, meist auf harten Spaltenböden. Wir wollten sehen, wie es anders gehen kann und haben ein Rudel Schwäbisch-Hällischer Landschweine besucht, die in einem Freilichtmuseum in Süddeutschland auf einer großen Weide leben.

- Schwein gehabt
- Schweine sind soziale Rudeltiere
- Schweine sind intelligent
- Schweine sind verspielt und neugierig
- Schweine sind Allesfresser
- Von wegen Dreckschwein
- Vorteile der Freilandhaltung
- Welche Rassen sind geeignet
- Die Anforderungen sind hoch
- Es muss sich lohnen
- Freiland-Schweinefleisch im Supermarkt
- Rasseportrait: Schwäbisch-Hällisches Landschwein
- Knappe Rettung
- Alte Haustierrasen interessierten wenige
- Immer noch gefährdet
- Aussehen
Die ökologische Schweinehaltung liegt hierzulande bei unter 2 Prozent. Diesen Biotieren muss Tageslicht und frische Luft geboten werden, meistens durch Zugang zu einem eingezäunten Auslauf. Dieser schließt sich an den festen Stall an, ist oft betoniert und teilweise überdacht und mit Einstreu und Wühlmaterial ausgestattet.
Eine richtige Freilandhaltung, bei der Schweine entweder saisonal oder das ganze Jahr hindurch auf mit Hütten oder Unterständen ausgestatteten Weiden, im Wald oder auf Streuobstwiesen leben, wird in der kommerziellen Schweinezucht sehr selten praktiziert. Wenn wir Borstenvieh im Grünen sehen, handelt es sich meistens um Tiere, die privat als Hobby oder zur Selbstversorgung sowie in Tierparks gehalten werden.
Schwein gehabt
Zu den wenigen Tieren, die das Glück haben, uneingeschränkt draußen zu leben, zählt ein Rudel Schwäbisch-Hällischer Landschweine in einem Freilichtmuseum in Baden-Württemberg. Den Tieren steht auf dem weitläufigen Gelände mit historischen Bauernhäusern, Mühlen und Werkstätten eine große Weide zur Verfügung. In einem kleinen Stall lädt eine dicke Strohschicht zum gemütlichen Nickerchen ein. Neben der längeren Nachtruhe schlafen Schweine gerne auch tagsüber manchmal für mehrere Stunden. Und das am liebsten in Gemeinschaft.
Schweine sind soziale Rudeltiere
Bei Tieren in Freilandhaltung kann man gut beobachten, wie sozial Schweine sind. Sie sind nicht gerne allein, suchen ständig die Nähe ihrer Artgenossen und unternehmen im Grunde alle Aktivitäten wie Kuscheln, Ruhen und Nahrungssuche gemeinsam. Die Tiere achten aufeinander, „unterhalten“ sich mit vielfältigen Grunzlauten, streiten auch mal lautstark und können untereinander enge Freundschaften schließen.
Schweine sind intelligent
Studien geben Grund zu der Annahme, dass die Tiere nicht nur mindestens so intelligent wie Hunde sind, sondern auch über emotionale Intelligenz und Empathie verfügen. So haben sich Schweine in Experimenten schon gegenseitig aus unangenehmen Situationen gerettet und sind zu Hilfe geeilt, wenn Rudelmitglieder gestresste oder ängstliche Laute von sich gaben.
Schweine sind verspielt und neugierig
Unter unseren Schwäbisch-Hällischen Landschweinen war ein besonders verspieltes Exemplar, das ständig irgendwelche gefundenen Stöckchen oder ausgegrabenen Wurzeln wie ein Hund aufnahm und durchschüttelte, im Maul durch die Gegend trug, oder darauf herumnagte. Wenn ihm Artgenossen das Spielzeug wegnehmen wollten, rannte es davon und ließ sich jagen.
Außerdem waren die Tiere extrem neugierig. Besucher wurden mit freundlichem Grunzen begrüßt und Hosen, Schuhe und Hände durch den Zaun hindurch beschnüffelt. Aber auch alle möglichen Laute zum Beispiel von anderen Tieren oder Autos ließen die Schweine in ihren Beschäftigungen sofort innehalten und lauschen. War das Geräusch interessant genug, liefen sie schnell zum Zaun, um ja nichts zu verpassen.
Schweine sind Allesfresser
Auf der Weide fressen sie Gras und andere Pflanzen, aber auch Aas und Insekten. Da Schweine einen ausgeprägten Jagdtrieb haben, werden auch Mäuse und andere kleine Wirbeltiere zur Strecke gebracht. Ich habe einmal erlebt, wie ein offensichtlich lebensmüdes Huhn in einen Schweinestall flog. Nach ein paar Minuten waren nur noch ein paar Federn von ihm übrig.
Auf der Suche nach Nahrung wühlen die Tiere mit ihrer starken Rüsselschnauze den Boden auf, um an Wurzeln und Knollen heranzukommen. Früher haben Landwirte diese Eigenschaft genutzt und Schweine auf Brachland getrieben, damit sie dieses urbar machen, indem sie Unkraut und Wurzeln fressen und den Boden lockern und regelrecht umpflügen.
Von wegen Dreckschwein
Ein Wasserloch darf auf einer Schweineweide nicht fehlen. Die Tiere können nicht schwitzen und haben eine sehr empfindliche Haut. Das Suhlen dient der Abkühlung und der Schlamm auf der Haut bietet Schutz vor Sonnenbrand und Insektenstichen.
Vorteile der Freilandhaltung
In der industriellen Massentierhaltung werden die Schweineschwänze meistens routinemäßig kupiert, um das weit verbreitete Schwanzbeißen zu verhindern. Ausgelöst wird diese Verhaltensstörung unter anderem durch Stress aufgrund von Mangel an Beschäftigung, zu wenig Platz und fehlender Reize von außen. Auch einseitige Ernährung, schlechtes Stallklima und genetische Veranlagung können das gegenseitige Abbeißen der Schwänze begünstigen.
In der Freilandhaltung kommt diese Verhaltensstörung so gut wie nie vor. Hier leben die Tiere im sozialen Gruppenverband und haben genug Platz und Bewegung in einer interessanten Umgebung, die erkundet werden kann. Sie sind den unterschiedlichen Witterungs- und Klimareizen ausgesetzt und können ihre natürlichen Verhaltensweisen wie Suhlen, Wühlen und Ruhen gut ausleben. All das führt zu einer besseren Gesundheit und mehr Wohlbefinden. Vor allem die Freilandhaltung auf natürlichem Boden ist die extensivste, beste aller Haltungsformen und kann als artgerecht bezeichnet werden, da sie der natürlichen Lebensweise von Schweinen am ehesten entspricht.
Welche Rassen sind geeignet
Die für die heutige Intensivhaltung gezüchteten Hybridschweine kommen im Freiland nicht so gut zurecht. Bei ihnen besteht das Zuchtziel im schnellen Wachstum von magerem Fleisch und guter Futterverwertung. Eigenschaften wie Robustheit werden vernachlässigt, sodass die für die Stallhaltung vorgesehenen Tiere sehr empfindlich und krankheitsanfällig sind. Im Freiland können sich Hybridschweine den unterschiedlichen Witterungsverhältnissen vor allem aufgrund der fehlenden Speckschicht und des dünnen Borstenfells schlecht anpassen, haben schnell Sonnenbrand, sind für unebenen Boden nicht trittsicher genug und bei der eigenständigen Suche nach natürlicher Nahrung nicht sehr kompetent.
Anders verhält es sich bei alten Schweinerassen wie dem Mangaliza-Wollschwein, dem Bentheimer Landschwein und den verschiedenen Sattelschweinen. Bei ihnen wurden Merkmale bewahrt und züchterisch gefördert, die aus Zeiten stammen, als es gar keine andere Haltungsform als die im Freiland auf Weiden oder im Wald gab. Die alten Landrassen sind robust und wenig krankheitsanfällig, stressunempfindlich, haben eine hohe Fruchtbarkeit, gute Muttereigenschaften sowie ein freundliches Wesen. Selbst das einfache, auf der Weide wachsende Grundfutter wird gut verwertet. Des Weiteren macht ihr dichtes, dem Wildschwein ähnliches Borstenfell und eine natürliche dicke Fettschicht die Tiere widerstandsfähig gegen Wind und Wetter, sodass sie mit einem trockenen Unterstand sogar ganzjährig draußen leben können.
Die Anforderungen sind hoch
Die Freilandhaltung bietet gegenüber der Stallhaltung vor allem hinsichtlich des Tierwohls zahlreiche Vorteile, ist jedoch auch wesentlich arbeits- und kostenintensiver. So muss im Vergleich zur Stallhaltung insgesamt mehr Fläche pro Schwein vorhanden sein, damit es nicht zu einer Umweltbelastung durch Überdüngung mit den Tierfäkalien kommt. Aufgrund des höheren Energiebedarfs durch Bewegung und Anpassung an kältere Witterung muss außerdem immer zugefüttert werden.
Durch das Wühlen wird Grünland in „Acker“ umgewandelt, was ebenfalls ein Nachteil für die Umwelt ist und durch eine geringe Besatzdichte oder mehrere Weideflächen zum Wechseln eingeschränkt werden sollte. Des Weiteren dürfen Weideflächen für Schweine nicht zu steil sein und keinen lehmigen Untergrund haben, da dieser bei Regen leicht verschlammt, was zu Klauenproblemen und Parasitenbefall führen kann.
Eine gute Hygiene und regelmäßige Behandlungen gegen Parasiten sind in der Freilandhaltung unerlässlich. Außerdem muss die Einfriedung stabil und sicher sein, um die Infektionsrisiken und die Gefahr der Seuchenverbreitung durch den Kontakt zu Wild- und Haustieren zu minimieren. In diesem Zusammenhang muss der Landwirt auch Unterbringungsmöglichkeiten für den Fall schaffen, dass sein Betrieb in einer seuchengefährdeten Zone liegt und Stallpflicht angeordnet wird.
Es muss sich lohnen
Die aufwändige, traditionelle Freilandhaltung alter Schweinerassen ist für Landwirte nur dann attraktiv, wenn sie das Fleisch der Tiere entsprechend gewinnbringend vermarkten können.
Inzwischen hat es sich auch bei Verbrauchern herumgesprochen, dass nicht nur dem Borstenvieh ein Leben im Freien und natürliches Futter zu einer schmeckbar besseren Fleischqualität führt. Während früher der Konsumentenwunsch eher in Richtung mageres Fleisch ging und die modernen Hochleistungshybriden dahingehend gezüchtet wurden, ist inzwischen das fettere, marmorierte und dadurch saftigere Fleisch von alten Landschweinrassen wieder beliebt. Eine steigende Nachfrage kann nicht nur die Existenz der Landwirte mit Freilandhaltung sichern, sondern auch mehr Tieren ein artgerechtes Leben ermöglichen sowie zum Erhalt dieser in ihrem Bestand gefährdeten Rassen beitragen.
Freiland-Schweinefleisch im Supermarkt
Die Supermarktkette Waitrose, die in Großbritannien über 350 Filialen betreibt, plant, ab 2027 nur noch Fleisch von Schweinen anzubieten, die ausschließlich im Freiland gehalten werden.
Um den Erzeugern Planungssicherheit zu bieten, werden 10-Jahresverträge angeboten. Bereits im Oktober 2025 wurde mit der Umstellung des Sortiments begonnen. Über Bezugsquellen muss sich Waitrose keine Sorgen machen, denn, anders als in Deutschland, sollen fast ein Drittel aller Zucht- und Jungschweine in Großbritannien im Freien gehalten werden.
Rasseportrait: Schwäbisch-Hällisches Landschwein
Die Rasse entstand um 1821 in der Umgebung der württembergischen Stadt Schwäbisch Hall durch Kreuzung verschiedener heimischen Landschweinen mit dem aus China importierten Maskenschwein.
Vorher gab es keine gezielte Schweinerassezucht in Deutschland. Die damals gehaltenen Landschweine ähnelten noch stark hatten noch viel Ähnlichkeit mit Wildschweinen. Das Schwäbisch-Hällische Landschwein gilt als älteste, traditionsreichste deutsche Schweinerasse und zählt gemeinsam mit Angler- und Deutschem Sattelschwein zur Gruppe der Sattelschweine.
Die drei deutschen Sattelschwein- Rassen sehen sich ziemlich ähnlich.
Knappe Rettung
Nachdem in den 1960er Jahren die Intensivzucht von Einheitsschweinen begann, die schnell wuchsen, mageres Fleisch hatten und industriell gehalten werden konnten, nahmen die Bestände sämtlicher traditioneller Landrassen rasant ab. Das Schwäbisch-Hällische Landschwein jedoch hat dank der Hartnäckigkeit einiger baden-württembergischer Bauern überlebt.
Mit der Intensivzucht von Einheitsschweinen ab den 1960er Jahren nahmen die Bestände sämtlicher traditioneller Landrassen rasant ab. Einige, wie das Deutsche Weideschwein und das Baldinger Tigerschwein, starben unwiederbringlich aus. Das Schwäbisch-Hällische Landschwein überlebte dank hartnäckiger Bauern in Baden-Württemberg.
In den 1980er Jahren begann die von Rudolf Bühler gegründete Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, die Rasse aus Restbeständen systematisch neu aufzubauen. Als wichtiger Nebeneffekt blieb dadurch auch die traditionelle Freilandhaltung erhalten. Sämtliche Sattelschweinrassen sind robust, zutraulich und im Gelände trittfest, wodurch sie für die Freilandhaltung bestens geeignet sind.
Alte Haustierrasen interessierten wenige
Die 1981 in Bayern von Dr. Hans Hinrich Sambraus mitgegründete Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) mit Wissenschaftlern und Biologen machte die Gefahr des Verlusts des Schwäbischen-Hällischen Schweines und den dringenden Handlungsbedarf einer breiteren Öffentlichkeit bewusst. Das Engagement zur Bewahrung alter Nutztierassen wurde jedoch größtenteils als Hobby einiger Intellektueller belächelt und auch die meisten Landwirte sahen die Zukunft der Schweinezucht in modernen Hochleistungshybriden.
Die sich mühsam erholenden „Mohrenköpfe“ erlangten jedoch, aller Häme zum Trotz, im Laufe der Zeit durch Präsentationen auf der Grünen Woche in Berlin und Preise für die besondere Fleischqualität sogar internationale Beachtung. Mit der wachsenden Nachfrage an Zuchttieren stieg auch der Herdbuchbestand. Heute sollen wieder über 1.000, überwiegend ökologische Betriebe diese Rasse züchten.
Immer noch gefährdet
Heute gilt das Schwäbisch-Hällische Landschwein gemäß Roter Liste der GEH immer noch als stark gefährdet. Die anderen Sattelschwein- Rassen Angler-Sattelschwein, Deutsches Sattelschwein und Rotbuntes Husumer Schwein werden sogar als extrem gefährdet eingestuft.
Aussehen
Beim originalen Schwäbisch-Hällische Landschwein sind der Kopf-Hals- Bereich sowie das Hinterteil schwarz mit grauen Säumungsstreifen. Der Sattel dazwischen sowie die Beine sind weiß. Es kommen jedoch auch Tiere mit vielen Flecken und hellem Kopf vor, die trotzdem als Schwäbsich-Hällische Landschweine gelten.